
Wie versucht wird, die Zivilgesellschaft zu delegitimieren

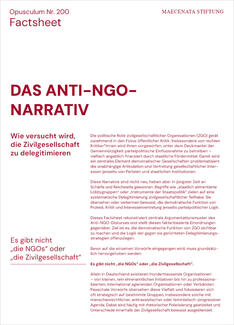
Die politische Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen (ZGO) gerät zunehmend in den Fokus öffentlicher Kritik. Insbesondere von rechten Kritikerinnen und Kritikern wird ihnen vorgeworfen, unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit parteipolitische Einflussnahme zu betreiben – vielfach angeblich finanziert durch staatliche Fördermittel. Damit wird ein zentrales Element demokratischer Gesellschaften problematisiert: die unabhängige Artikulation und Vertretung gesellschaftlicher Interessen jenseits von Parteien und staatlichen Institutionen.
Diese Narrative sind nicht neu, haben aber in jüngster Zeit an Schärfe und Reichweite gewonnen. Begriffe wie "staatlich alimentierte Lobbygruppen" oder "Instrumente der Staatspolitik" zielen auf eine systematische Delegitimierung zivilgesellschaftlicher Teilhabe. Sie übersehen oder verkennen bewusst die demokratische Funktion von Protest, Kritik und Interessenvertretung jenseits parteipolitischer Logik.
Auf Basis des ZiviZ-Surveys haben Dr. Peter Schubert (Zivilgesellschaft in Zahlen) und Dr. Siri Hummel (Maecenata Institut) ein Factsheet erarbeitet, das der Versachlichung der Diskussion dienen soll.
Das im September 2025 veröffentlichte Paper rekonstruiert zentrale Argumentationsmuster des Anti-NGO-Diskurses und stellt diesen faktenbasierte Einordnungen gegenüber. Ziel ist es, die demokratische Funktion von ZGO sichtbar zu machen und die Logik der gegen sie gerichteten Delegitimierungsstrategien offenzulegen.
Es gibt nicht "die NGOs" oder "die Zivilgesellschaft"
Allein in Deutschland existieren Hunderttausende Organisationen – von kleinen, rein ehrenamtlichen Initiativen bis hin zu professionalisierten, international agierenden Organisationen oder Verbänden. Pauschale Vorwürfe übersehen diese Vielfalt und fokussieren sich oft strategisch auf bestimmte Gruppen, insbesondere solche mit menschenrechtlicher, antirassistischer oder feministisch-progressiver Agenda. Dabei wird häufig mit rhetorischer Polarisierung gearbeitet und Unterschiede innerhalb der Zivilgesellschaft bewusst ausgeblendet.
- Vorwurf: ZGO machen linke Politik
Zivilgesellschaftliche Organisationen wird vorgeworfen, dass sie ein verlängerter Arm linker oder progressiver Politikerinnen und Politiker wären.
Faktencheck: Zivilgesellschaft ist vielfältig
Ja, es gibt ZGO, die linke Positionen vertreten, es gibt aber auch welche, die liberale sowie konservative Positionen einnehmen. Zudem existieren auch rechtsextreme Vereine und Stiftungen. Die Zivilgesellschaft ist eine Abbildung der gesamten Gesellschaft – in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit.
- Vorwurf: ZGO haben zu viel Einfluss, obwohl sie nicht gewählt sind
Ein weiterer Vorwurf lautet, ZGO hätten zu viel Einfluss auf Politik und Medien und würden demokratische Verfahren unterlaufen.
Faktencheck: Richtig ist: ZGO können Einfluss nehmen, aber nur in sehr begrenztem Rahmen
Sie verfügen über keine gesetzgeberischen Befugnisse, sondern bringen Wissen, Kritik und öffentliche Aufmerksamkeit in politische Prozesse ein oder reichen Klagen ein, um Sachverhalte vor Gerichten prüfen zu lassen – so wie es auch andere gesellschaftliche Gruppen tun. Die zivilgesellschaftliche Landschaft ist zudem hochgradig vielfältig und keineswegs ein homogener Machtblock: Im Jahr 2025 existierten in Deutschland 662.789 zivilgesellschaftliche Organisationen. Im Vergleich zu Wirtschafts- und Unternehmenslobbys sind ZGO strukturell deutlich schwächer ausgestattet und haben geringeren Zugang zu Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Gerade deshalb versuchen sie, auf Politik Einfluss zu nehmen, um den Interessen ihrer Mitglieder und Unterstützerinnen und Unterstützer Gehör zu verschaffen. Dabei handelt es sich oft um unterrepräsentierte Interessen.
- Vorwurf: Profitinteressen, Selbstbereicherung und Abhängigkeit
Kritikerinnen und Kritiker werfen ZGO vor, verdeckt Profitinteressen zu verfolgen – etwa im Zusammenhang mit dem Schlagwort "Asylindustrie". Zudem wird behauptet, ZGO erhielten übermäßig viel staatliche Förderung, seien finanziell von dieser abhängig und schafften sich selbst gut bezahlte Tätigkeiten.
Faktencheck: Zivilgesellschaft bedeutet, prekäre Arbeitsbedingungen treffen auf einen breiten Finanzierungsmix
Nur ein kleiner Teil der Beschäftigten arbeitet hauptamtlich, die Anstellungen sind meistens befristet, und die Gehälter liegen in der Regel deutlich unter vergleichbaren Positionen in der Privatwirtschaft. Bei der Finanzierung dominiert Eigenleistung: Mitgliedsbeiträge, private Spenden und selbsterwirtschaftete Mittel machen den größten Anteil aus. Öffentliche Förderungen spielen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Gerade bei öffentlichen Förderungen ist der Berichts- und Nachweisaufwand besonders hoch. Kleine Organisationen mit Budgets unter 100.000 Euro finanzieren sich überwiegend durch Mitgliedsbeiträge.
- Vorwurf: Intransparenz
Auch die Verfahren staatlicher Förderung werden als intransparent kritisiert und zudem mit Steuerverschwendung gleichgesetzt.
Faktencheck: Es bestehen bereits heute zahlreiche Transparenz- und Kontrollmechanismen
Viele ZGO veröffentlichen freiwillig Jahres- und Finanzberichte sowie Mitgliederzahlen. Zudem ermöglichen Register wie das Vereinsregister Einblicke. Eine einheitliche Offenlegungspflicht existiert jedoch nicht. Der Status der Gemeinnützigkeit kommt aber mit einer hohen Nachweispflicht einher, ebenso sind die Richtlinien öffentlicher Förderungen häufig sehr umfangreich. Eine Initiative aus der Zivilgesellschaft für mehr Transparenz ist die 2010 gegründete "Initiative transparente Zivilgesellschaft". Über 2.000 Organisationen haben sich selbstverpflichtet, mehr als zehn Transparenzkriterien regelmäßig offen zu legen.
- Vorwurf: Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit
ZGO wird vorgeworfen, sie würden mit ihrem politischen und medialen Einfluss unliebsame Meinungen unterdrücken und so eine Form von Zensur betreiben. Besonders im Bereich Antidiskriminierung ist häufig von "Cancel Culture" die Rede.
Faktencheck: Kritik an diskriminierenden Positionen ist keine Zensur, sondern selbst Ausübung von Meinungsfreiheit
ZGO verfügen über keinerlei staatliche Gewalt – sie können weder rechtlich noch institutionell jemanden zum Schweigen bringen. Wer ZGO "Zensur" vorwirft, ignoriert somit die klare juristische Definition dieses Begriffs. ZGO stellen vielmehr Öffentlichkeit her, benennen Missstände, solidarisieren sich mit Betroffenen – und verteidigen damit demokratische Diskursräume, die durch Hassrede zunehmend unter Druck geraten. Ihre Interventionen sind nicht Ausdruck autoritärer Macht, sondern notwendige zivilgesellschaftliche Gegenrede in einer polarisierten Öffentlichkeit.
Fazit
Die Kritik am zivilgesellschaftlichen Sektor folgt einer klaren Logik: Was unbequem ist, muss diskreditiert werden – durch Pauschalisierung, selektive Empörung, Skandalisierung und Überspitzung. Die Analyse zeigt jedoch: Das Anti-NGO-Narrativ operiert mit empirisch kaum haltbaren Thesen, strategischen Verkürzungen und einer bemerkenswerten Ignoranz gegenüber Forschungslage und Verfassungslage. Statt einer strukturellen Machtkritik bleibt es bei einem ideologischen Zerrbild, das professionelle Organisationsstrukturen mit Machtübernahme verwechselt und gemeinwohlorientiertes Engagement mit Pfründesicherung.
Was bleibt, ist der Versuch einer politischen Delegitimierung unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeitsdebatte. Die Zivilgesellschaft ist kein homogenes Machtkartell, sondern ein komplexes Geflecht pluraler Interessen, das in der Demokratie nicht das Problem ist, sondern – in aller Ambivalenz – Teil ihrer Lösung.
